Am 3. Juni ist Weltfahrradtag. Dieser Tag des Fahrrads wurde in Europa bereits im Jahr 1998 ins Leben gerufen, um auf das Fahrrad als umweltfreundlichstes und gesündestes Fortbewegungsmittel hinzuweisen. Am 12. April 2018 wurde der 3. Juni dann auch als ein offizieller UN-Tag des Bewusstseins über die gesellschaftlichen Vorteile der Fahrradnutzung verabschiedet. Auch im nationalen „Plan national de la mobilité“ wird dem Fahrrad eine wichtige Rolle zugeteilt. Es ist „das Verkehrsmittel, dessen Nutzung in den kommenden Jahren den stärksten Zuwachs verzeichnen muss“. Ist dies nicht der Fall, wird „sich die individuelle Mobilität in den Ballungsgebieten erheblich verschlechtern“. In Zeiten von Klimakrise und Mobilitätschaos ist das Fahrrad ein wichtiger Teil der Lösung. Laut einer Studie der Universität Lund in Schweden spart eine Gesellschaft bei jedem mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer 30 Cent. Die Kosten, die durch das Auto verursacht werden, fallen weg und da Fahrradfahren gesünder ist, wird das von der Allgemeinheit finanzierte Gesundheitssystem weniger belastet. Hinzu kommt, dass das Fahrrad seit der Pandemie einen großen Aufschwung erlebt. Eine Umfrage von TNS Ilres belegte, dass im Jahr 2020 fast 60 Prozent der Einwohner Luxemburgs mit dem Rad gefahren sind. Bei den Kindern (94 Prozent der Sechs- bis Zwölfjährigen) und Jugendlichen (77 Prozent der 13- bis 17-Jährigen) sind die Zahlen noch höher.
Dies sind alles Argumente, welche Bürgermeister*innen nutzen könnten, um die Fahrradinfrastruktur in ihren Gemeinden zu verbessern und auszubauen. Zudem beteiligt sich der Staat finanziell am Ausbau der Radwege. Während es bei einer Radinfrastruktur mit nationalem Charakter eine hundertprozentige staatliche Unterstützung gibt, wird jeder Anschluss an das nationale Fahrradnetz mit 30 Prozent subventioniert. Trotz dieser Maßnahmen fehlt es aber in vielen Gemeinden an einem zusammenhängenden Radnetz und dem politischen Willen, dieses Defizit zu beheben. Am Beispiel der Stadt Esch wird dies besonders deutlich. Der Liedtitel des deutschen Satirikers Jan Böhmermann „Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?“ könnte für die Escher Fahrradinfrastruktur geschrieben worden sein. Ein Beispiel ist die schlechte Anbindung an das vom Staat finanzierte „Vëlodukt“. An anderen Orten wird der Radweg von einer Bushaltestelle (rue Jean-Pierre Michels) unterbunden, gibt es keine Trennung zwischen Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen (Boulevard Charles de Gaulles) oder ist der Radweg lebensgefährlich (rue du Canal). Während der Escher Bürgermeister das Rad als „die Lösung für eine ganze Reihe von Problemen“ bezeichnet hat, sieht der lokale Mobilitätsplan der Stadt Esch, für den er die Verantwortung trägt, keine zusätzlichen Fahrradwege vor. Der im Koalitionsabkommen vorgesehene Ausbau der sanften Mobilität sieht lediglich eine bessere Beschilderung der Fahrradwege vor.
Dabei muss die Frage aufgeworfen werden, was andere Städte besser machen als die Stadt Esch. Ein oft genanntes Modellbeispiel für sanfte Mobilität ist die dänische Stadt Kopenhagen. Sie gilt seit Jahren als fahrradfreundlichste Stadt der Welt. In Kopenhagen wird der Standpunkt vertreten, dass getrennte Fahrradwege für das Radfahren in der Stadt unabdingbar sind. Die Radwege werden nach dem Prinzip geplant, dass Radfahrer*innen grundsätzlich nicht auf die Straße gehören, sondern auf den Radweg. So sehen sich Radfahrer*innen und Autofahrer*innen nicht als Gegner, sondern als gleichwertige Partner. In dieser Partnerschaft haben beide das „Recht auf Stadt“, wie es der französische Philosoph Henri Lefebvre bereits 1968 formulierte. Der Radweg ist aber nicht nur von der Straße, sondern auch vom Fußweg getrennt, so werden auch die Konflikte zwischen Fußgänger*innen und Radfahrer*innen reduziert. In Esch hingegen sind die Radwege meist direkt an der Straße und ohne Schutzzone angelegt. Ein weißer Strich, ein Straßenschild und der Fahrradweg ist fertig. Dies führt dazu, dass Radfahrer*innen oft von auf dem Fahrradweg haltenden Autos blockiert werden. In der Kanalstraße werden sie teilweise von zwei Seiten bedrängt. Auf der linken Seite fahren die Autos und rechts öffnen sich die Türen der geparkten Autos.
Dabei sind sich viele Experten und Expertinnnen mittlerweile einig, dass es vor allem ein gesteigertes Sicherheitsempfinden ist, das dafür sorgt, dass immer mehr Menschen das Fahrrad als städtisches Fortbewegungsmittel nutzen. Ohne eine bessere Fahrrandinfrastruktur und gesicherte Radwege gibt es aber kein gesteigertes Sicherheitsempfinden. In Städten wie Esch, in denen das Sicherheitsempfinden nicht gewährleistet ist, sind Radfahrer oft Männer. Einige minimieren die Gefahren oder benutzen eher irrationale Argumente, wie „ich fahre, seit ich Kind bin, durch die Kanalstraße und hatte noch nie Angst dort“. Frauen hingegen nehmen die real existierende Gefahr öfters als Hinderungsgrund fürs Radfahren wahr – und sehen diese nicht als „sportliche“ Herausforderung. Bessere und sichere Fahrradwege wären also auch ein Schritt für mehr Gleichberechtigung. In Kopenhagen beispielsweise, einer Stadt mit sicheren Radwegen, stellen somit auch Frauen die Mehrheit der Radfahrer dar. Ein Zeichen, dass Sicherheit und Sicherheitsempfinden sehr hoch sind.
Um Strategien und Lösungsansätze für ein zusammenhängendes Fahrradnetz auszuarbeiten, ist es außerdem von großer Bedeutung, die Radfahrer*innen an der Ausarbeitung eines zusammenhängenden Fahrradkonzeptes zu beteiligen. Gemeinsam mit den Verkehrsplanern der Stadt sollte sich damit beschäftigt werden, wie die Bedürfnisse der Radfahrer*innen und Fußgänger*innen am besten koordiniert werden könnten. Ein weiterer Vorschlag wäre die Schaffung einer Art „Bicycle director“, wie es in ihn in anderen Städten gibt. Dieser begleitet die von den Radfahrer*innen entwickelten Vorschläge und überwacht die Umsetzung des Fahrradkonzeptes. Eine zusätzliche Alternative wäre die Schaffung einer Stiftungsprofessur für Radverkehr an der Universität Luxemburg, an der sich die Gemeinde finanziell beteiligen könnte. Durch eine solche Stiftungsprofessur könnte das Fahrrad mehr in den Fokus rücken und die Entscheidungen wissenschaftlich begleitet werden. Um ein aufschlussreiches Stimmungsbild zu liefern, müssten die Escher Bürger*innen in regelmäßigen Abständen nach ihrer Meinung über die Fahrradinfrastruktur befragt werden. Im Sinne der Transparenz müssten die Bürger*innen der Stadt die Antworten online nachlesen können. 25 Jahre nach der Einführung des Weltfahrradtags bedarf es also mehr als eines weißen Strichs auf dem Asphalt. Es ist Zeit für eine „Velosophie“ für Esch.

 Zu Demaart
Zu Demaart


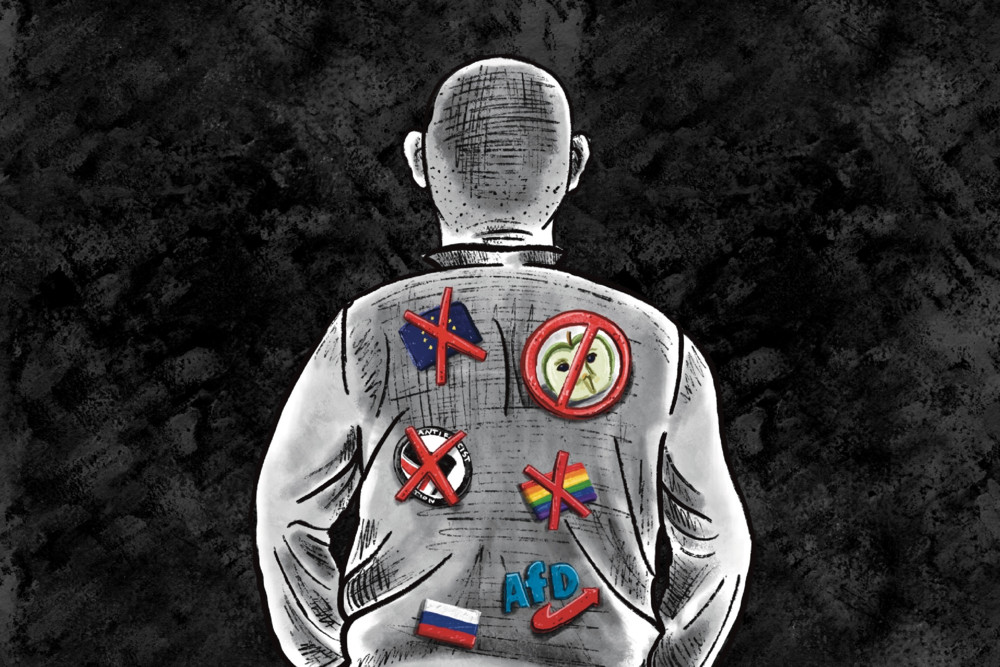




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können