Woher die zündende Idee für das „Buergbrennen“ kommt, ist nicht genau geklärt. Die Tradition könnte von den Römern stammen. Nach deren Kalender beginnt das Jahr nämlich am 1. März. Wie die Menschen heute begrüßten auch die Römer das Neujahr mit einer Sause – samt großem Feuer. Allerdings könnten auch die Kelten und Germanen mit ihren heidnischen Festen zur Frühjahrs-Tagundnachtgleiche die Vorlage für den Brauch geliefert haben. Sie haben große Rad- oder Sonnenkreuze verbrannt, um die bösen Geister des Winters zu vertreiben. „Nach den langen Monaten der Dunkelheit sollte die Sonne dazu animiert werden, wieder länger und stärker zu scheinen“, erklärt Jeannot Nehrenhausen. Der ehemalige Französisch-Lehrer des „Nord-Lycée“ hat sich intensiv mit der Herkunft der Luxemburger Tradition auseinandergesetzt.
Den Feuern wurde auch eine heilende Magie zugeschrieben. „Schon in der Jungsteinzeit wurde die übrig bleibende Holzkohle unters Tierfutter gemischt, um Krankheiten abzuwenden und die Gesundheit der Herde zu gewähren“, sagt Nehrenhausen. „Manchmal wurden die Herden sogar durch die Überreste des erloschenen Feuers getrieben.“ Mit Magie hat die heilende Wirkung der Holzkohle nichts zu tun. Kohle bindet Bakterien, Gift- und Schadstoffe und kann besonders gegen Magen- und Darmbeschwerden helfen. In der Tierhaltung beweisen Studien von Rinderzüchtern, dass sich schon nach wenigen Wochen der Gesundheitszustand ihrer Herden deutlich verbessert, wenn Pflanzenkohle ins Futter gemischt wird. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Gülle stinkt weniger.

„Außerdem wurde Holzkohle der Feuer auf den Feldern verteilt. Ihre Magie sollte eine gute Ernte garantieren“, sagt Nehrenhausen. Hinter dem Aberglauben steckt wieder ein wissenschaftlich nachweislicher Nutzen: Durch Aschedüngung werden dem Boden neue Nährstoffe zugeführt und die Kohle bindet auch im Boden Gift- und Schadstoffe. „Bei den heidnischen Festen zum Frühlingsanfang spielt also auch die Fruchtbarkeit und das Glück eine wichtige Rolle“, sagt Nehrenhausen. Diese Assoziation könnte der Grund sein, wieso seit dem 19. Jahrhundert in vielen Luxemburger Gemeinden traditionell das zuletzt verheiratete Paar die „Buerg“ anzünden darf. Und es dürfte der Grund sein, wieso das „Buergbrennen“ auch gutes Wetter vorhersagen können soll: „Wéi den Damp op Buergsonndeg geet, sou geet de ganze Virsommer.“
Bevor Wetterenthusiasten allerdings am „Buergsonnden“ das Wetter der kommenden Wochen festlegen können, steht erst mal eine ganze Menge Arbeit ins Haus. In Luxemburg wird die Feier traditionell von den Vereinen in den einzelnen Gemeinden organisiert. In Rodange richtet die „Amicale Nidderréideng“ das „Buergbrennen“ auf der „Dänneknippchen“ aus. „Dieses Jahr errichten wir zum 65. Mal unsere Burg“, erzählt Vereinsmitglied Jean-François Schrank stolz. Schon im November beginnt der Verein mit der Vorbereitung. „Erst mal werden die vom Förster vorgezeichneten Tannenbäume gefällt. Dann müssen wir diese zuschneiden und zur ‚Dänneknippchen‘ transportieren.“ Zwischen 130 und 150 Tannenbäume werden für den Bau der Rodanger „Buerg“ gebraucht.

Die zentrale Stütze bildet ein 12 bis 13 Meter langer Tannenbaumstamm. „Wir setzen ihn in ein 1,5 Meter tiefes Loch. Früher mussten wir ihn mit langen Heugabeln und Stangen lange genug aufrecht halten, bis das Loch zugeschüttet und der Stamm fixiert war“, erinnert sich Schrank lachend. „Das war jedes Mal ein ziemliches Abenteuer.“ Heutzutage hilft die moderne Technik. Ein spezieller Hebekran des Unternehmens „Toiture Mehlen“ macht den Prozess für alle Beteiligten leichter und sicherer.
Auf der 3 mal 3 Meter großen Grundfläche ragt die „Buerg“ in Rodange beeindruckende 10 Meter in die Höhe. Gefüllt wird jede Schicht mit Holzpaletten und den Überresten der gefällten Tannenbäume. „Am Ende haben wir mehr als 90 Kubikmeter Holz verbaut“, sagt Schrank. Er betont allerdings, dass diese ganze Arbeit nicht nur an einem Wochenende erledigt werden kann. Bis zu 35 aktive Vereinsmitglieder sind ab Januar immer wieder mit dem Aufbau der Burg beschäftigt.
Am Sonntagabend, dem 1. März wird „Amicale Nidderréideng“ den Winter mit ihrem „Buergbrennen“ verjagen. Natürlich mit einer großen Feier mit traditionellem Essen und frischen Getränken. „Ab 14 Uhr ist bei uns jeder willkommen“, sagt Schrank. Eintritt wird nicht verlangt. In Rodange gibt man sich allerdings nicht nur mit dem Verbrennen einer „Buerg“ zufrieden. Besucher können sich kurz vor dem Entzünden der Burg um 20 Uhr auf ein Feuerwerk freuen. „Das Geld dafür sammeln wir im Dorf zusammen. Außerdem ist die Gemeinde unser langjähriger Partner und stellt uns eine Erlaubnis aus.“ Bereits am Samstagabend, dem 29. Februar geht es auf der „Dänneknippchen“ schon lebhaft zu. Zum zweiten Mal organisiert der Verein eine „Buergparty“, bei der unter anderem eine „Kannerbuerg“ von 2,5 Metern aufgebaut und verfeuert wird.
Einer der Bräuche, die in Rodange verschwunden sind, ist die Nachtwache vor der fertig aufgebauten „Buerg“. Früher bewachten Mitglieder der beteiligten Vereine ihre Burg. Und zwar vor dem Verein der Nachbargemeinde, die die „Buerg“ der Lokalrivalen schon früher als geplant abgefackelt sehen wollte. Darauf angesprochen, lacht Schrank: „Das ist schon lange nicht mehr so. Das war noch vor meiner Zeit beim Verein. Aber es wird sich erzählt, dass solche Sachen mal vorgekommen sind.“
Wieso heißt das „Buergbrennen“ eigentlich „Buergbrennen“?
„Mit dem Abfackeln einer Burg aus Stein hat der Brauch nichts zu tun“, sagt Jeannot Nehrenhausen. Früher habe man fälschlicherweise die Tradition auf die Zerstörung der Burgen während der Französischen Revolution zurückgeführt. „Doch das ist historisch völlig falsch.“ Er vermutet, dass der Name von dem lateinischen Verb „comburo“ für „Verbrennen“ kommt.
Laut Sam Mersch ist die Geschichte des Namens des Brauchtums nicht ganz so einfach. Mersch promovierte in historischer Linguistik der Luxemburger Sprache an der Uni Luxemburg. Die Wurzel des Wortes liege wahrscheinlich im lateinischen Verb „burare“. Dieses Verb sei aber schriftlich nicht bekannt, sondern stammt aus der gesprochenen lateinischen Sprache. Das habe schon mit Feuer und mit etwas verbrennen zu tun, als „Verbrennenbrennen“ könne man das „Buergbrennen“ allerdings nicht einfach übersetzen. Sondern eher als „das Anzünden eines Feuers oder das Verbrennen von brennbaren Materialien“, so Mersch.
Vom gesprochenen Latein seien romanische Sprachen beeinflusst worden, insbesondere der „Patois d’Ardennes“. „Dort findet man die Wurzel in dem Wort ,bure‘ wieder, was dann im Luxemburgischen als ,baier‘ übernommen wurde. Aus dem heutigen Luxemburgisch ist das Wort wieder verschwunden“, sagt Mersch. Nur der „Baiersonndeg“, auf Französisch „Dimanche des bures“, verweist noch auf die romanische Wurzel. Der wiederum auf den ersten Fastnachtssonntag fällt, in denselben Zeitrahmen wie die meisten „Buergbrennen“ in Luxemburg.
Allerdings gebe es noch andere Einflüsse: In der Eifel, wo es ähnliche Traditionen wie das „Buergbrennen“ gibt, bezeichne man das Fest noch heute als „Hüttenbrennen“. „Das zeigt, dass es schon einen Zusammenhang mit dem Verbrennen einer Behausung bei dem Brauch gibt“, sagt Mersch. Die Luxemburger hätten wohl einfach die sprachlich am nächsten an „baier“ gelegene Behausung gewählt, die sie in ihrer Sprache kennen. So wurde das „Buergbrennen“ zum „Buergbrennen“.
Was hat es mit der Form der „Buerg“ auf sich?
Wer schon auf mehreren „Buergbrennen“ quer durchs Land war, stellt schnell fest: Fast jeder Verein wählt für seine „Buerg“ eine andere Form. Einige bevorzugen ein Kreuz, andere zünden ein Konstrukt an, dass einer großen Strohpuppe ähnelt. Wieder andere bauen eine ganze Burg oder beschränken sich nur auf einen hohen Turm. Oder es ist nur ein riesiger Haufen aufgeschichtetes Holz, der abgebrannt wird. Einen Konsens, wie die perfekte „Buerg“ auszusehen hat, gibt es scheinbar nicht.
„Die Tradition des Kreuzes könnte auf einer vereinfachten Form der Rad- oder Sonnenkreuze der Kelten und Germanen beruhen“, sagt Jeannot Nehrenhausen. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass auch das Christentum eine Rolle bei dieser Form gespielt habe. „Viele heidnische Gebräuche wurden von der christlichen Kirche übernommen oder zumindest wurde ihnen eine christliche Haube aufgesetzt“, sagt Nehrenhausen. So habe in vielen Luxemburger Gemeinden früher der Pfarrer die „Buerg“ gesegnet. Wer nun den Vergleich mit den brennenden Kreuzen des rassistischen Ku-Klux-Klans zieht, der kann beruhigt sein: Mit dieser Sekte haben die kreuzförmigen „Buergen“ überhaupt nichts zu tun.
Die Strohpuppen scheinen, wie auch die Kreuze, auf die frühen Ursprünge des Brauches zurückzugehen. Die Figur steht sinnbildlich für die bösen Geister des Winters. Burgen und Türme wurden besonders in den letzten Jahrzehnten sehr populär und leiten sich meist von dem Namen des Brauches ab.
Wieso ist das „Buergbrennen“ in Luxemburg so beliebt?
Das „Buergbrennen“ ist keine rein luxemburgische Tradition. Auch in Belgien, Deutschland und Frankreich wurde der Brauch gefeiert. Doch während die Tradition des „Buergbrennen“ in weiten Teilen der Nachbarländer ausgestorben ist, brennen in fast 75 Prozent aller Gemeinden in Luxemburg die Feuer jedes Jahr am ersten Sonntag nach Karneval lichterloh. „In der Eifel gibt es heute noch das ,Hüttenbrennen‘ und einige deutsche Gemeinden an der Grenze feiern ebenfalls „Burgbrennen“. In Ostbelgien sind die Feuer in den 1980 Jahren auch wieder populär geworden“ sagt Jeannot Nehrenhausen.
Er vermutet, dass der Brauch in Luxemburg ebenfalls fast verschwunden war, bis man sich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die heimischen Bräuche besinnt. „Als eine Art Protestaktion auf das Verbot der Luxemburger Traditionen unter den Nazis wollte man sich nach dem Krieg von den Deutschen abgrenzen und sich nun erst recht auf alles typisch Luxemburgische konzentrieren.“ Dass es in den 1950er Jahren hierzulande ein sehr reges Vereinsleben gegeben habe, könnte dem Brauch zugutegekommen sein. Denn fast alle „Burgbrennen“ in Luxemburg werden damals wie heute von Vereinen organisiert.

 Zu Demaart
Zu Demaart



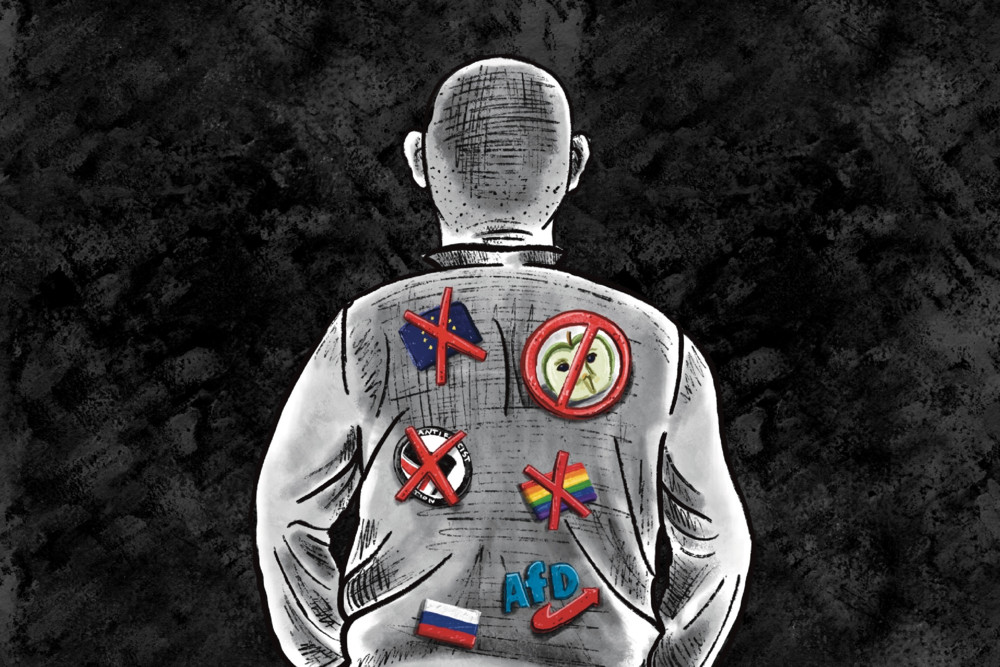




Wieso? Damit die Leute Feinstaub und giftige Sporen aus uralten Strohballen einatmen können. Und da gehen auch noch Leute mit Kindern hin.
Wenn ich eine alte Palette im Garten verbrenne, kommt die Polizei. Und die verbrennen hunderte davon plus mit Pilzsporen durchsetzte Heuballen und niemand reklamiert. Noch so ein dämlicher Aberglaube der auf den Müllhaufen der Geschichte gehört.