Um Versäumnisse geht es nicht nur in „Drei Worte hin und her“, Margret Steckels in Irland spielendem Roman über eine Dreiecksbeziehung mit verheerenden Folgen. Die Begegnung mit dem literarischen Schreiben hätte Steckel selbst fast verpasst, wie es Michel Raus im kurzen Nachwort zur 1997 mit dem Servais-Preis ausgezeichneten Erzählung „Der Letzte vom Bayrischen Platz“ zu bedenken gibt.
„Nach dem Abitur hätte Margret Steckel, Jahrgang 34, liebend gern ein Literaturstudium aufgenommen, nur, der Tochter aus klassenfeindlichem Elternhaus ist im ersten Arbeiter- und Bauernparadies auf deutschem, auch auf mecklenburgisch ländlichem Boden, akademische Weiterbildung verwehrt –, die alten Eliten gehören untergepflügt.“
Die Welt der erzählenden Kunst lässt sie jedoch nicht ganz fallen und arbeitet, nachdem sie die DDR 1955 verlassen hat, als Dramaturgin in der Filmbranche, wo sie u.a. auch Synchronbücher übersetzt und ein Drehbuch nach einem eigenen Roman verfasst.
Der nächste „Schicksalsknick“, so Raus, führt sie jedoch nicht auf die „parkettglatte Laufbahn der Schriftstellerei, sondern auf den beschwerlichen Schmalsteg eines Daseins als Ehe-, Hausfrau und Mutter“, und zieht sie nach Irland, wo sie ein Fernstudium in Deutscher Literatur absolviert. 1983 zieht sie nach Luxemburg und arbeitet als freie Schriftstellerin. Ihr erster Roman, „Nie wieder irgendwo“, erscheint nach einer Dekade an verschiedenen Literaturauszeichnungen und Veröffentlichungen in Deutschland und Luxemburg und stellt den Beginn einer vielfältigen und äußerst produktiven Schriftstellerkarriere dar.
Wie sehr verpasste Chancen im eigenen Leben das Werk eines Schriftstellers prägen können, davon zeugen u.a. die Romane des Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro, dessen Vaters Beruf die Familie zum Umzug nach England zwang und den fünfjährigen Kazuo um eine japanische Kindheit brachte. Wem das Leben so deutlich signalisiert, dass es nur ein „Schicksalsknick“ war, der zum jetzigen Leben führte, entwickelt meist nicht nur ein akutes Feingefühl für Versäumtes, sondern auch ein helles Interesse für die ewige Frage, die unser Vorstellungsvermögen antreibt: „What if?“ – „Was wäre, wenn?“
„Immer am Rande des Traums“

Bevor Steckels Texte allerdings von dieser Melancholie des Versäumten und der Unentschiedenheit zwischen möglichen Schicksalswegen geprägt werden, erscheint 1996, inmitten des Wusts hiesiger, meist traditionsbewusster literarischer Texte, bei denen die Erzählfigur den Zugang zur und die Rekonstruktion der fiktionalen Außenwelt mithilfe einer geradlinigen, naturalistischen Erzählung erleichtert, die mutige, dekonstruktivistische, von der literarischen Postmoderne geprägte Erzählung „Der Letzte vom Bayrischen Platz“.
Der erste Satz ist dabei schon so toll, wie eine Ouvertüre von Camus oder Céline: „Nun war in letzter Instanz die Katze schuld“ – eine gierige Katze, deren Kopf in einem leeren Weckglas feststeckt, weil sie darin einen Vogel erblickt hat, der auf dem Grund des Glases eine Fliege sah: Dieser „perfekte Reigen der Gefräßigkeit, der sie alle drei in die Falle gelockt hat“, wäre fast schon lustig, wäre er nicht, fast wie in einer Fabel von La Fontaine, das treffende Bildnis für die darauffolgende Erzählung – und hätte er nicht zeitgleich zur Hospitalisierung Hajos geführt.
Mithilfe von Rückblenden schildert der bettlägerige Erzähler Erinnerungen aus dem nationalsozialistischen Berlin der 30er und der Nachkriegszeit, die durch seine Erkrankung zu einem halluzinogenen Fiebertraum verschmelzen, in dem die verschiedenen Zeitebenen ineinander greifen: „Wie eine Boje schwankt mein Kopf, mal schwimmt er oben und überblickt Zusammenhänge, dann wieder schwappt alles über ihm zusammen.“
Im Laufe von Hajos zersplitterter Erzählung begegnen wir seinem bestem Freund Hackenberger, dessen Tod an der Front er nicht wahrhaben will, einem „verlogenen“ KZ-Koch, der „so übertrieb, dass man’s merkte“ – zumindest will man nicht glauben, wovon dieser berichtet, weil es auf etwas „Unbeschreibliches, Unnennbares“ hindeutet, das sich dem Bewusstsein (noch) entzieht –, Captain Combs, der Hajo aus dem Hungerlager herausschmuggelt, damit dieser „die Ursache der Katastrophe“ entschlüsselt und im Trümmerfeld der Hauptstadt, „zwischen Häusergerippen und Schuttbergen“, „in der Mondlandschaft, die einen anfletscht wie ein Totenkopfbiss“, die „Schwarze Box“ des braunen Desasters sucht.
In dieses Kaleidoskop der Verwüstung nisten sich immer wieder Rückblenden ein, die davon zeugen, wie schnell sich der bedrohliche Schleier des Antisemitismus über die unbeschwerten Tage mit der Berliner Clique legt: Als ein paar Vandalen in Wilkows Eiskonditorei mit Eis auf Dekor und die Besitzer dieser „Judenwirtschaft“ werfen, wird sich erstmal am Wort „Rowdytum“ festgehalten. „Doch mit einem Mal begreifen wir: Das Wort reicht nicht mehr; es ist zu klein, zu schwach für den kalten Luftzug, der uns streift, uns zur Seite weht. Hier am Straßenrand geschieht es, hier nehmen die Spätzünder erstmal Witterung der Geister auf.“
Steckels Werk ist immer dann am stärksten, wenn es die Kluft zwischen unserem Wirklichkeitsbild – diesem kognitiven Habitus – und der in diesem Falle unfassbaren Realität aufzeigt: „Als man erfahren soll, dass die Welt im Kopf nicht viel mit der da draußen gemein hat, ist es bereits zu spät“, beginnt die Kurzgeschichte „Mauerblümchen“ (2).
Der hektische, parataktische Stil der Erzählung erinnert an Célines „Voyage au bout de la nuit“, die bedrohliche Stimmung, die von einer Stadt ausgeht, in der das „sieggewohnte Getöse unter der Sonne des Führers“ hallt und Antisemitismus nicht nur salon-, sondern auch konditoreifähig wird, an die ersten Romane von Patrick Modiano, die syntaktisch und semantisch gesprengte Schilderung eines chaotischen, aber auch schelmischen Parcours an der Front und im Nachkriegsberlin an Thomas Pynchons „Gravity’s Rainbow“: Mit wenigen präzisen Pinselstrichen gelingt es Steckel auf empathische Weise, Figuren zu skizzieren, die alsbald von dem schlimmsten aller Episoden der Menschheitsgeschichte zermalmt werden.
„Auf die Bestie Mensch kannst du nur schießen“

„Die Schlingarme der Träume wollen mich auch im wachen Zustand nicht freigeben. Denn da haben sie ihr Vorzimmer, die Erinnerung“, klagt Hajo gegen Ende seiner Erzählung. Kriegsbedingte Traumata, die den Alltag nachhaltig prägen und das Weiterleben erschweren, die Durchlässigkeit unserer Erinnerungen, ihre Unschärfe, aber auch die Präzision verschiedener markanter Schlüsselszenen sind einige der Hauptmerkmale von Steckels Werk, das sich oft von autobiografischen Elementen inspiriert, um seine präzisen Fiktionswelten zu inszenieren.
Themen wie die unbeschwerte Kindheit in Mecklenburg, die durch den Kriegseinbruch eine dunkle, aber auch abenteuerliche Wende bekommt („Jette, Jakob und die anderen“), oder das Emigrantenleben in Irland („Drei Worte hin und her“) durchziehen das Werk so sehr, dass man nicht nur wiederkehrende Leitmotive erkennt, sondern ganze Ausdrücke, Szenen oder gar Figuren manchmal von einer Erzählung zur nächsten wandern: Im Zentrum der Kurzgeschichte „Wenn Tante Anna kommt“ steht eine erkrankte Figur, die während einsamer Herbsttage in ihrem Rollstuhl sitzt, auf die Buchen starrt und sich „in jedem niedersinkenden Blatt fühlt“.
Fünf Jahre nach dem Erzählband „Ins Licht sehen“ erscheint „Daisy Fiedler“, für die die namenlose Figur der Kurzgeschichte Modell gestanden haben muss – denn den Vergleich mit dem niedersinkenden Blatt wird auch Daisy Fiedler machen, deren Körper, nachdem ihre beiden Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen und sie zudem Schwierigkeiten hat, die Kriegserinnerungen aus ihrer Kindheit zu verarbeiten, Lähmungserscheinungen entwickelt.
Da sie nicht mehr ohne Rollstuhl auskommt, verbringt sie ihre Tage in einem Heim, wo sie den lebensbejahenden Daniel kennenlernt, der sie trotz – oder gerade wegen, wirft ihm Daisy später vor – ihrer Krankheit liebt.
Dass Daniels Lebensfreude jedoch auch Schattenseiten hat, die durch Lektüren wie Solschenizyns „Archipel Gulag“ langsam überhandnehmen, erkennt Charlie erst zu spät: „Damals scheute ich vor jedem dunklen Vorzeichen, jetzt, da alles längst vorbei ist, darf ich warnende Signale nachträglich erkennen.“ Die Tragik vieler von Steckels Erzählungen steckt im Kontrast zwischen dem Scharfsinn des rückblickenden und der Naivität des erlebenden Ichs.
Im Laufe des kurzen Textes verdichtet die Erzählfigur Charlie auf ergreifende Art eine lebenslange Bindung zu einem Menschen, erzählt von der Kontingenz der ersten Begegnung bis hin zur Evidenz einer überdauernden Freundschaft, im Laufe derer man die Schicksalsschläge des Anderen mal aus schmerzhafter Nähe, mal aus fast gleichgültiger Distanz miterlebt. Die Erzählfigur plagt dabei das schlechte Gewissen umso mehr, weil Freundschaft, wie die Liebe bei Proust, mal mehr, mal weniger intensiv gelebt wird.
Dazu gesellt sich die Erkenntnis, dass wir unsere Mitmenschen, ganz gleich wie nahe sie uns stehen, nie vollends kennen, weswegen bei Steckel die Fiktion die Lücken unserer Kenntnis des Anderen zu füllen vermag – selbst wenn uns das Vorstellungsvermögen vielleicht, wie es die Hauptfigur in „Verschenkt“ vermutet, auf den Holzweg führt. Nachdem Charlie eine Szene rekonstruiert hat, fügt sie, quasi als Fußnote, hinzu: „Gedanken von heute, meine Gedanken, nicht die von Daisy. Ich weiß nicht, was sie dachte.“
„Und dann begann der Krieg“

„Erinnerungen kümmern sich nicht um Wind und Wetter, mit Regentagen haben sie wenig im Sinn, es sei denn, Langeweile gebiert Dummheiten oder Poetisches. Aber meistens halten sie es mit der Sonne. Da scheint’s einen uralten Vertrag zu geben.“ Dass die Erinnerung an die dunkelste aller Zeiten nicht nur in Grau- und Braunstichen geschildert werden muss, hatte Steckel bereits mit „Der Letzte vom Bayrischen Platz“ gezeigt; in der Novelle „Jette, Jakob und die andern“ hat dies vor allem damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg aus der naiv-klugen Perspektive von ein paar Dorfkindern erzählt wird.
Was wie ein Märchen beginnt – „Es waren einmal zwei Kinder, wie Hänsel und Gretel oder Brüderchen und Schwesterchen“ –, muss wie ein Märchen weitererzählt werden. Denn auch wenn das blanke Überleben und die Flucht aus der DDR als Happy-End-Ersatz herhalten müssen, ist Steckels Novelle umso wirkungsvoller, da jedes Kind weiß, dass die meisten Märchen nicht eben eine „Glitzerwelt“ hervorzaubern, sondern dass ihnen auch Teufel, Oger und Hexen innewohnen.
In Steckels Novelle werden die Alltagssorgen einer Dorfkindheit aus den 30ern – Kinderkrankheiten, damals weit schlimmer als heute, der manchmal unheilvolle Leichtsinn des kindischen Spieltriebes – recht abrupt von den bedrohlichen Vorzeichen des Krieges weggefegt.
Die Mutter, die trotz der Verbote Hitler immer nur „den Braunen“ nennt und den Londoner Rundfunk hört, der Vater, der in den Krieg ziehen muss, die Flüchtlinge, die sich im Familienhaus einquartieren, die gleichgültigen Tommies, die gefürchteten Russen, die wie „Kartoffelmännchen“ aussehen, die Erzählungen, an deren Beginn nicht mehr „Es war einmal“, sondern nun „Und dann kam der Krieg“ steht, der unkaputtbare Gerechtigkeitssinn der Mutter, den selbst ein Besuch von den „Männern in Ledermänteln“ nicht eindämmen kann, und das finale Bild einer zerstörten Stadt, das den Bogen zum „Bayrischen Platz“ spannt – all dies wird aus der einfühlsamen Perspektive der jungen Jette geschildert.

Aber Steckel verdichtet auch andere Kapitel deutscher Geschichte: Während die meisten Geschichten von „Ins Licht sehen“ einsame Figuren porträtieren, die eine besondere Begegnung – mit einem Hund an der Costa Brava, einem Franzosen im Nachtzug, einem Arzt nach einem Selbstmordversuch, dem schönen Philipp beim Schulball – erleben oder erleben möchten, versteht man im experimentelleren „Packeis“ nicht sofort, was Sache ist, bis das Zusammenspiel von hetero- und homodiegetischer Erzählperspektiven dem Leser erlaubt, die Tragik einer gescheiterten Flucht nach Westdeutschland zusammenzusetzen.
The Irish Patient

Ein anderes, leicht klischeebehaftetes Motiv ist das der Beziehung zwischen Arzt und Patientin, das im Roman „Drei Worte hin und her“ angedeutet und später in der Kurzgeschichte „Verschenkt“ noch einmal erzählt wird: Als die Malerin Linn ihrem Mann Holger, den es aus beruflichen Gründen dorthin verschlägt, nach Irland folgt, kann sie diesem Land und seinen Einwohnern erst einmal wenig abgewinnen.
Die irische Mentalität, die von einer Melancholie geprägt ist, die „in Jahrhunderten der Armut und Unterdrückung“ nur wuchs, der verwirrende Sprachgebrauch (Linn ist überzeugt, dass die Iren sogar auf ihrem Sterbebett noch behaupten, ihnen gehe es „großartig“) oder ihre irritierende, fast schon faule Genügsamkeit – „eine lächelnde Mauer, gegen die der ausländische Unternehmer anrannte“ … – all dies erschwert es der gebürtigen Schwedin, das Leben im Exil zu genießen. Relativ rasch werden Holger und Linn Teil eines gutbürgerlichen Mikrokosmos, eines Wohlstandsteichs, in dem Neureiche und verarmte Adelige plantschen und sich mit Gin Tonic die Zeit totschlagen.
Teil dieser Gemeinschaft ist Mike Quigley, ein attraktiver Frauenarzt, dem jede Menge Frauengeschichten nachgesagt werde. Eine innige, aber verheerende Liebe wird Linn und Mike auf ewig verbinden.
Dieser Geschichte über eine Wohlstandsblase, in der – Michael Ondaatjes „The English Patient“ nicht unähnlich – das Leben von zwei Menschen aufgrund einer stürmischen Liebe aus den Fugen gerät, fehlt leider die erzählerische Dringlichkeit. Das eingeschobene Krimi-Intermezzo wird zu schnell und reibungslos aufgelöst, der langsame Sturz des Arztes in die Depression und den Alkohol verliert durch die hochtrabenden Dialoge genau das an Tragik, was der Roman an Pathos gewinnt.
Überzeugen tut „Drei Worte hin und her“ immer dann, wenn Steckels feinsinnige Beobachtungsgabe durchscheint und die Autorin das Leben in einem Land, dessen Einwohner die Konsequenzen von Armut, geschichtlicher Unterdrückung und Bigotterie tragen müssen, seziert.
Das Monument: „Servais“
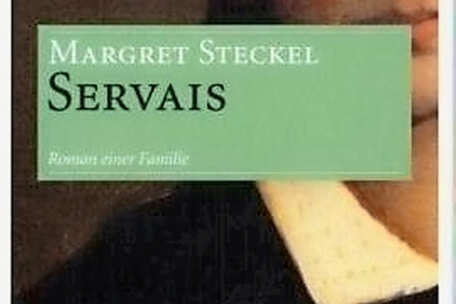
In einem literarischen Feld, das von Kurzgeschichten, Novellen oder Romanen, die mehr der französischen Tendenz zu kurzen Texten als der deutschen Neigung zu Schmökern nachgehen, beeindruckt Steckels „Servais“ bereits durch seinen schieren Umfang: Mit über 570 Seiten reiht sich ihr 2010 erschienenes Werk nicht nur in die mit Thomas Manns „Buddenbrooks“ begonnene Tradition des deutschen Familienromans ein, sondern stellt auch in Sachen Volumen eine Art Luxemburgensia-Rekord dar.
Der Roman über eine der bedeutendsten Luxemburger Familien ist dabei zeitgleich Metaroman – indem Steckel die Geschichte des Servais-Hauses, in dem sich heute das CNL befindet, nacherzählt, stellt ihr Roman so etwas wie eine Luxemburgensia-„Origin Stories“ dar: Wer sich für hiesige Literatur begeistert, wird die etlichen Seiten, in denen Steckel feinfühlig die Maison Servais beschreibt, umso präziser lesen, da er das Haus mehrmals im Jahr aufsucht – wie auch das, was Literaturwissenschaftlerin Linda Hutcheon „metafictional historiography“ nennt.
So ist der Umgang mit dem historischen Material, das der Schriftstellerin von Emmanuel Servais aus seinem Privatarchiv zur Verfügung gestellt wurde, einerseits präzise – im Gegensatz zu Pynchons „Mason & Dixon“ gibt es hier nichts, was einem sonnenbrillentragenden Abraham Lincoln ähnelt und historische Quellen wie Gemälde sind nicht nur in den Roman hineingewoben, sondern dienen den konkreten Extrapolationen der Erzählstimme –, andererseits ist Steckels allwissende Erzählerin im Hier und Jetzt verankert.
So wagt sie Vergleiche zwischen Gegenwart und Geschichte, die sowohl die Idee einer historisch-objektiven Wahrheit dekonstruieren als sie der Universalität menschlicher Gefühle Tribut zahlen: „Eine Lacroix“, triumphiert so der ehrgeizige Philippe Lacroix, als er erfährt, dass er die schöne Catherine heiraten darf. „Der junge Mann von heute wäre in seinen Turnschuhen die Straße hinuntergesprungen. Philippe, der Herr Notarius, geht beschwingten Schrittes zu seinem Lieblingsstandort auf der Brücke.“ Solche bedeutenden Zeitsprünge zwischen den Welten – das kann nur die Literatur.
(1) Neben dem im Rahmen der Walfer Bicherdeeg jährlich verliehenen Lëtzebuerger Buchpräis und dem Prix Servais, der jedes Jahr das wichtigste Werk des Vorjahres auszeichnet und den Steckel 1997 für ihre fragmentarische Kriegserzählung „Der Letzte vom Bayrischen Platz“ erhielt, zeichnet der Prix Batty Weber seit 1987 alle drei Jahre eine*n Schriftsteller*in für ihr Gesamtwerk aus.
(2) Die im Artikel erwähnten Kurzgeschichten stammen allesamt aus dem Erzählband „Ins Licht sehen“.

 Zu Demaart
Zu Demaart








Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können