„Die Tagebücher der Tannen“ erkunden mittels eines schier unerschöpflichen Vorrats an kühnen Metaphern eine Welt des bürgerlichen Mittelmaßes. Die Sprachprogramm stößt hier und da an seine Grenzen, doch trotzdem sollte man sich das Werk nicht entgehen lassen.
Von Jeff Thoss
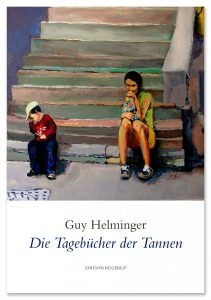 Nein, hier ist die Poesie nicht zu Hause, in der Welt, die Guy Helminger in seinem neuen Gedichtband beschreibt. Man frühstückt auf der Terrasse, mit Blick in den Garten, in dem das Blumenbeet ganzjährig blüht, der Mirabellenbaum die Vögel anlockt und die Gartenzwerge geduldig auf die nächste Grillparty warten. „Im Nachbarhaus läuft Beethoven / aus Kinderhänden“, während man sich der Tatsache erfreut, dass „hohe Zäune die Nachbarschaft erhalten“.
Nein, hier ist die Poesie nicht zu Hause, in der Welt, die Guy Helminger in seinem neuen Gedichtband beschreibt. Man frühstückt auf der Terrasse, mit Blick in den Garten, in dem das Blumenbeet ganzjährig blüht, der Mirabellenbaum die Vögel anlockt und die Gartenzwerge geduldig auf die nächste Grillparty warten. „Im Nachbarhaus läuft Beethoven / aus Kinderhänden“, während man sich der Tatsache erfreut, dass „hohe Zäune die Nachbarschaft erhalten“.
Was soll hier schon passieren, wo das Wochenend-Highlight ein Turnwettbewerb ist und die kleinbürgerliche Idylle allenfalls von Voyeuren und Einbrechern bedroht wird, die man sich in Form von plüschenen Weihnachtsmännern an die Fassade gehängt hat? „Sogar der Wind / bremst in dieser 30er-Zone“ und auch „den Hecken hatte man es bereits gezeigt sie / wuchsen als Geometrie um das potentielle / Laubbläsergebiet“.
Postmoderne Peripherie
Ein erstes Fazit bei der Lektüre von „Die Tagebücher der Tannen“ lautet: Die romantische Naturdichtung hat ausgedient, die moderne Großstadtlyrik ebenso. Helminger sucht sich seine Sujets in einer postmodernen Peripherie, in den Außenbezirken und Vororten, in denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit wohnt und denen der Ruf Monotonie und Spießigkeit anhaftet.
Den Dichter interessieren die charakterlosen Zwischenräume, die es für gewöhnlich zu durchqueren gilt, um in aufregende Innenstädte oder traumhafte Naturlandschaften zu gelangen.
Aber welche Sprache spricht die Schrebergartensiedlung? Welche poetische Form eignet sich für Mehrzweckhallen und Maulwurfshügel, die dem klassischen Lyrikkanon doch nicht mal einen jambischen Fünfheber wert gewesen sind?
Auf den ersten Blick wirken Guy Helmingers Gedichte unscheinbar. Die etwa gleichlangen Verse sind meist zu gewöhnlichen Zweizeilern arrangiert. Die vielen Enjambements stören den Lesefluss kaum und die durchweg fehlende Interpunktion kann mental mühelos ergänzt werden. Aber so sehr die Syntax transparent bleibt, so sehr ist die Semantik opak.
Darin liegt das Trügerische an diesen Texten: Man meint, einfach so über sie hinweglesen zu können, und gerät dabei schnell ins Straucheln, denn der Autor fährt so ziemlich alles auf, was das Rhetorikwörterbuch an Tropen hergibt.
Metaphern, Metonymien und Personifikationen werden in einer „Explosion von Begriffsmigränen“ durch die Zeilen geschleudert, die zwar nicht gleich Kopfschmerzen bereiten, aber doch einiges an kognitiver Arbeit abverlangen. Helmingers Verfahren ist ein additives, das die Sprachbilder massiert und in Serie abfeuert – nicht immer mit Rücksicht auf die Leser*innen. So kann es passieren, dass der Dichter einem davoneilt und bereits neue Wege eingeschlagen hat, während man noch unschlüssig an der ersten Gabelung steht und die Schilder zu entziffern versucht.
Gerade mit Blick auf das Verhältnis von Wörtern und Dingen fasziniert der Band allerdings immer wieder mit seinen Wendungen. „Die kahlen Äste pinnten ihre Langzeilen an / die Federwolke“, liest man da, oder auch: „Mir zerriss es die Sätze / zu Schneekristallen“. Insgesamt oszillieren die Gedichte zwischen der sprachlichen Darstellung einer Welt und der Präsentation einer Sprachwelt, in der Wörter eine greifbare Gestalt haben.
Das Ich und die anderen
Zwischen den gut gepflegten Reihenhäusern macht sich das lyrische Ich derweil rar. Bekenntnislyrik ist fehl am Platz in einer Welt, über die sich Aussagen treffen lassen wie: „’Ich‘ ist auch das laute / Geräusch der Kaffeeautomaten.“
Immerhin, eine ganze Sektion des Bands ist Liebesgedichten gewidmet. Leidenschaft und Ekstase finden allerdings im Präteritum statt. Früher „fütterten wir die Haare / mit Kokain“, erinnert sich der Sprecher. „Es gab eine Transformationsregel und die / riss uns jedes Mal die Kleider vom Leib.“ Heute laufen sich die einstigen Liebenden dagegen über den Weg, ohne sich überhaupt wiederzuerkennen.
Weit intensiver sind da die Begegnungen mit den Mitmenschen in der Nachbarschaft, auch wenn es darüber ebenfalls wenig Erfreuliches zu berichten gibt.
Ein leiser Protest gegen die Apathie und den Konsumismus der Mehrheitsgesellschaft durchweht das Buch und wird gelegentlich auch explizit formuliert: „uns beruhigt die / Melodie der Müllabfuhr die Gewissheit uns / auch heute in einen Stillstand hinein zu / bewegen der uns auseinanderreißen wird Wir / lesen dass wir nichts tun können und sind / zufrieden mit der Richtung in die der Wind die / Halme bläst.“
Zufrieden mit der Richtung, in die die Welt sich bewegt, ist Guy Helminger keinesfalls. Bei seinem Versuch, eine Sprache für unsere Vorstadtexistenz zu finden, fördert er viel Verqueres zutage. Manches davon überfordert, aber vor geistiger Ödnis ist man in diesen Schrebergärten sicherlich gefeit.

 Zu Demaart
Zu Demaart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können