Peter Rüedi, der großartige Kolumnist der Weltwoche, schrieb einmal Folgendes über Michel Petrucciani: „Die Emotionen, die der Pianist, von der Glasknochenkrankheit zum Zwerg gestaucht, am riesigen Konzertflügel auslöste – die ganze ebenso abscheuliche wie unvermeidliche Mischung aus Rührung, Mitleid, Bewunderung und jahrmarkthafter Sensationsgeilheit –, verbauten dem Publikum die Wahrnehmung seiner wahren künstlerischen Statur.“ Genau, und wie genial der Mann, der die Pedalen seines Steinway-Konzertflügels nur dank speziell entwickelter Prothesen erreichte, wirklich war, kann man nun mithilfe von „The Montreux Years“ nachvollziehen, einer Zusammenstellung der Highlights seiner Auftritte beim Montreux Jazz Festival.
Petruccianis Sohn Alexandre hat aus der Vielzahl der Aufnahmen, die der Festivalbegründer Claude Nobs mitschneiden ließ, elf bislang unveröffentlichte Stücke ausgewählt, darunter Klassiker wie „Take the A-Train“ von Duke Ellington, den sein Vater sehr verehrte, „Autumn Leaves“ oder „Summertime“. 1993 lieferte sich der Tastenvirtuose, der seine Arme über 88 Tasten zum Flügelpaar spannte und sich förmlich gegen seine Verbannung seiner 92 Zentimeter Körpergröße unten am Boden aufschwang, Duelle mit dem Organisten Eddy Louiss, 1996 mit dem Bassisten Miroslav Vitous und 1998 klang Petruccianis Ensemble fast wie eine Bigband mit fetten Bläsersätzen. Alleine Miles Davis’ „So what“ geriet etwas zu brav im Vergleich zu seiner „Live in Tokyo“-Version mit Steve Gadd und Anthony Jackson, die das Maß aller Dinge bleibt.

Auch der Großmeister der Flamenco-Gitarre Paco De Lucia hat seine Montreux-Compilation erhalten und auch die ist atemberaubend gut. Die Mitschnitte der Konzerte der Jahre 1984, 2006 und 2012 sind, ähnlich wie beim Petrucciani-Album, nicht chronologisch angeordnet, sondern eher dramaturgisch, wodurch der Eindruck entsteht, man würde einem durchgehenden Konzert beiwohnen, zumal das Publikum bei sämtlichen Gigs sehr euphorisch drauf ist und auch soundtechnisch kaum Unterschiede auszumachen sind.
Wie immer bei Aufnahmen aus Claude Nobs’ Privatarchiv herrscht allerbeste Soundqualität vor, sodass auch Teil acht dieser Vinyl-Reihe ein Doppelalbum der Extraklasse darstellt. De Lucias Freund und musikalischer Partner John McLaughlin fiel die Ehre zuteil, die rührenden Liner Notes zu verfassen, in denen er unterstreicht, dass der Spanier nicht nur ein Genie an der Gitarre, sondern ebenfalls ein außergewöhnlicher Mensch und einer seiner besten Freunde gewesen sei.
In a New York State of Mind

Wir verlassen das Strawinsky-Auditorium, die Miles Davis Hall und das Casino von Montreux und treten in eine andere Kultstätte des Jazz ein: das New Yorker Village Vanguard, in dem einige der bedeutendsten Live-Alben der Jazzgeschichte mitgeschnitten wurden. Hier entstandene Aufnahmen von Sonny Rollins, Bill Evans, John Coltrane oder Cannonball Adderley zählen wahrlich zu den Sternstunden des Jazz. Zu den anerkanntesten Künstlern des Modernen Jazz zählen hingegen der Pianist Fred Hersch und die Bassistin und Sängerin Esperanza Spalding. Diese beiden sind nun Teil der renommierten „Alive At The Village Vanguard“-Reihe geworden, bei welcher immer zwei Ausnahmekünstler eingeladen werden, um in der legendären Venue ein unvergessliches Konzert zu spielen.
Das Resultat ist ziemlich ernüchternd. Da hatte man sich doch deutlich mehr erwartet. Zum einen spielt Spalding keinen Bass, zum anderen singt sie die endlos in die Länge gezogenen Standards wie „But not for me“ oder „Little Suede Shoes“ mit einer kindlich-kreischenden Stimme, die einem gehörig auf den Zeiger gehen kann und alles andere als sauber phrasierend. Hersch rettet mit seiner subtilen Klavierbegleitung und gelegentlichen Soloausschweifungen die Performance im gemütlichen Kellerclub, in dem jedoch eine sehr gute, entspannte Stimmung herrscht.
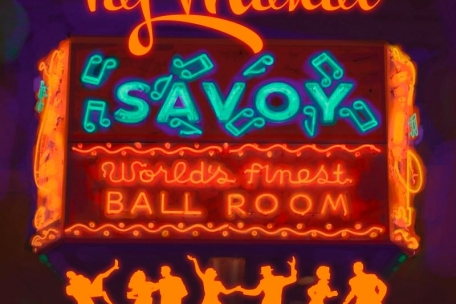
Taj Mahal – „Savoy: World’s finest Ball Room“ (7/10)
Vom Village Vanguard geht es dann von der 7th Avenue rüber nach Harlem ins ehrwürdige „Savoy“. Der 81-jährige Henry St. Clair Fredericks alias Taj Mahal, der erst im letzten Jahr zusammen mit Ry Cooder einen Grammy für das beste „Traditional Blues“-Album einheimste, hat dem „World’s finest Ball Room“ nun ein Denkmal gesetzt, indem er mit einem erstklassigen Swing-Orchester aus San Francisco viele Klassiker der 20er, 30er und 40er Jahre wie „Lady be good“, „Sweet Georgia Brown“ oder „Caldonia“ performt und auch zu scatten versteht. In „Stompin’ at the Savoy“ erzählt er die Geschichte, wie sich die eigenen Eltern damals in Harlem kennenlernten. Das ist Ahnenforschung, die Spaß macht und Taj Mahal auf seine alten Tage vielleicht noch einen weiteren Grammy einbringen wird.
Von Truffaut zu Truffaz

Eric Truffaz – „Rollin’“ (8/10)
Unsere Listening Session geht nun im Kino weiter. Der Schweizer Trompeter Eric Truffaz wurde gebeten, auf der Abschlusszeremonie des letztjährigen „Festival du film français d’Angoulême“ mit seiner Band ein bisschen Filmmusik zu spielen, was der Filmliebhaber und vor allem Filmmusik-Liebhaber nur zu gerne tat. Aus diesem Projekt ist das vorliegende Album „Rollin’“ entanden, das einige Perlen des „Film noir“ oder der „Nouvelle vague“ enthält, komponiert von den Großen der Zunft wie Ennio Morricone, Philippe Sarde oder Michel Magne.
Natürlich ist auch Miles Davis’ geniales Thema zu „Ascenseur pour l’échafaud“ mit dabei: eine Steilvorlage für Truffaz, dessen Ton auf seinem Instrument immer schon an Miles erinnerte. Und wenn man ihn so auf dem Cover betrachtet, könnte diese hagere Gestalt mit Filzhut, in sein Trompetenspiel versunken, selbst einem Film noir entsprungen sein. Einziges Manko ist bei dieser Produktion die Spielzeit von knapp 33 Minuten. Man hätte gerne noch gehört, was Truffaz’ Band aus „A bout de souffle“, „Le dernier tango à Paris“ oder vielleicht „Le chat“ gemacht hätte.

Lars Danielsson – „Symphonized“ (9/10)
Auch der Schwede Lars Danielsson macht so was wie Filmmusik und lässt Bilder über die Ohren ins Bewusstsein laufen, allerdings mit völlig anderen Mitteln. Der Kontrabassist präsentiert auf seinem neuen Album „Symphonized“ zusammen mit seinem Quartett Liberetto und dem Göteborger Symphony Orchestra sein Konzert für Oboe, Bass und Orchester. Und, so sagte er sich wohl, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, mit einem Spitzen-Orchester zusammenzuarbeiten, so macht man sich das doch maximal zunutze, und so legte er dem renommierten Ensemble neu arrangierte Partituren seiner interessantesten Liberetto-Stücke vor, die das Orchester hervorragend umsetzt. Igor Strawinsky hat sich immer für Jazz interessiert, was in seinen Werken nicht zu überhören ist, hier kriegt er so manches zurück.

Cécile McLorin Salvant – „Mélusine“ (6/10)
Auch bei Cécile McLorin Salvant greift die Bezeichnung Jazzsängerin zu kurz. Die US-Amerikanerin mit haitianischen Wurzeln, die sonst für ihre eigene Interpretation von Jazz-Standards aus dem American Songbook bekannt ist, legt ein Konzeptalbum namens „Mélusine“ mit gehöriger Bandbreite vor. Es sind Bearbeitungen von mythologischen Erzählungen aus völlig unterschiedlichen Zeitepochen und Kulturkreisen, aber auch von französischen Chansons von Léo Ferré oder Charles Trenet. Das ist nicht immer leicht verdaulich und auch an manchen Stellen etwas zu prätentiös, klingt aber hervorragend, ob sie nun im Duo oder mit ihrer Band interagiert. Mit der Melusina „im Gepäck“ ist sie bei uns ja eh goldrichtig.
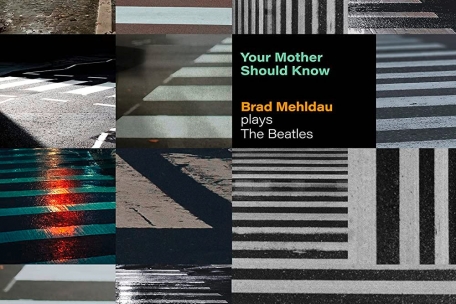
Von Clausen dann rüber in die Montée du Grund ins Café des Artistes, wo man sich Brad Mehldau zu später Stunde mit seinem Beatles-Repertoire nur zu gut am Klavier vorstellen könnte. Der amerikanische Jazzpianist holt auf seinem Album „Your Mother Should Know“ ganz schön viel raus aus der Musik der Fab 4, aber dann fehlt einem doch die eine oder andere Gesangspassage, wie z.B. bei „I am the Walrus“ Lennons unverzichtbares „I am the Eggman, They are the Eggmen, I am the Walrus – Googoo g’joob“. Der Höhepunkt des Albums kommt ganz am Ende mit „Life on Mars“: Wusste gar nicht, dass das von den Beatles ist.

 Zu Demaart
Zu Demaart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können