In seinem Essay „Warum hassen wir die Lyrik“ erforscht Ben Lerner die paradoxe Natur der Dichtkunst. Sich auf den Dichter Allen Grossman berufend schreibt er, es bestehe in der Dichtung „ein ,unlösbarer Konflikt‘ zwischen dem Verlangen des Dichters, eine alternative Welt zu singen“ und, wie Grossman es formuliert, ,dem Widerstand gegen ein alternatives Schaffen, der den Materialien innewohnt, aus denen sich jede Welt zwangsläufig zusammensetzt‘.“ Damit werde jedes Gedicht zur Manifestation eines Scheiterns und die Dichterin zu einer tragischen Gestalt. Lerner zufolge kann ein lyrischer Text also nicht gelingen, weil der Autor das, was er sagen möchte, nie auf vollkommene Weise aufs Papier bringen kann. Schuld daran sind die Grenzen, die die menschliche Sprache setzt.
Lerners Gedanken zur Lyrik haftet etwas Verwegenes und Radikales an; vor ihrem Hintergrund liest sich der neu erschienene Gedichtband „Schlupflöcher“ von Tamara Štajner mit umso größerem Interesse, denn die Autorin ist Violistin und, wie ihrer Vita zu entnehmen ist, „interdisziplinär tätig“, so „verbindet [sie] in ihrer Arbeit klassische Musik, Literatur, performative Klangkunst und visuelle Kunst“. Was sich vor der Lektüre ihres lyrischen Debüts nur hypothetisch formulieren lässt, kann danach als unzweifelhafte Gewissheit geäußert werden: Štajners Wandern zwischen den verschiedenen Künsten durchdringt auf einzigartige Weise ihre Gedichte. Ihre musikalische Versiertheit nutzt die in Slowenien geborene Autorin, um das lyrische Sprechen der Musik, die deren eigentliche Heimat ist, anzunähern und so eben jene Grenzen zu verrücken, die laut Grossman und Lerner dem Dichter bedeuten: Hier kommst du nicht weiter.
„Herbstfrische Septemberakkorde“
Der Bereich der Musik wird verschiedenartig in Štajners Texten aufgerufen. Schon im allerersten Gedicht „visions of reality“ ist immer wieder vom „Hören“ die Rede, auf dieses folgt dann ein kursiv geschriebener Einschub, meist in englischer Sprache („hören: you know when / yoko + john met / they took it slow know / the story“). Wie Satzfesten aus einer Radiosendung, die die Aufmerksamkeit des lyrischen Ichs immer wieder auf sich lenken, durchsetzen diese Einfügungen den Text. Das Bild der jungen Frau im Boho-Look und des bebrillten, langhaarigen Musikers, das sich beim Lesen der ersten Verse vor dem inneren Auge unweigerlich formt, deutet schon auf die thematische Richtung des Gedichts hin und erweist sich zugleich als eine Kontrastfolie. Denn verhandelt wird in „visions of reality“ nicht nur das Künstlerleben im Wien der Gegenwart, sondern auch die (hier schwierig scheinende) Liebe: „man erzählen lachen verliebt / schwören + später aus dem / staub machen verschwinden / flink + flott verschwinden / wochen später lesen: you ok / herzklappen aufatmen nicht / wollen aber“.
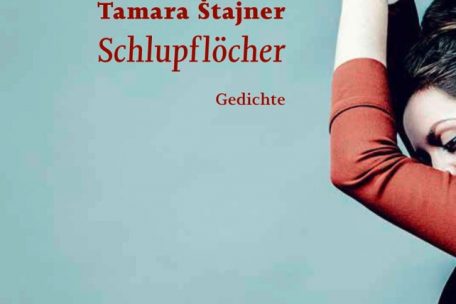
Für ihre durch und durch poetischen Sprachbilder bedient sich Štajner der Begriffswelt der Musik, spricht von „herbstfrische[n] September-/akkorde[n]“ und der „überleitung vom spätsommerintermezzo zur / herbstserenade“. Bei ihr gleitet schließlich „der spätsommer viert-/tönig behutsam ins früh-/herbstliche“. Der dritte Teil ihrer Anthologie ist mit „fermaten“ überschrieben: Die Fermate ist ein musikalisches Symbol über oder unter einer Note oder Pause, das dem Solisten anzeigt, diese Stelle nach eigenem Ermessen zu verzieren, oder auch ein Innehalten in der Bewegung kennzeichnet, das bedeutet, dass die Note oder Pause länger gespielt wird. Die Fermate, früher auch Corona genannt, wird in „Schlupflöcher“ nicht nur zur Metapher erhoben, sondern im Zusammenhang mit der Pandemie auch mit spezifischen Bedeutungen aufgeladen: Die Luft versuchen zu „halten“, müssen nämlich die vom Virus geschwächten Lungen. Für die Kranken, die ihr Bestes tun, um ihren eigenen Zustand „auszuhalten“ und um ihr Leben zu kämpfen, dehnt sich indes die Zeit bis ins Unermessliche aus. Diese scheint also selbst „angehalten“: „halten (weißt schon freispiel) / fermate halten atmen corona / atmen + halten lange / dauer vor der dauer weil / ja alles ja alles so lange / so lange / dauert“.
Von Veränderung und Auflösung
Ähnlich nutzt die Autorin auch den Begriff der Auflösung bzw. das Auflösungszeichen, das in der Notenschrift gebraucht wird, um das Ende der vormals angegebenen Tonhöhen-Alteration zu markieren, und eben das diese Veränderungen anzeigende typografische Zeichen (#). Dabei erscheint der Begriff Auflösung, aus dem spezifischen Kontext der Notation herausgehoben, ebenfalls als doppelbödig und so auch in der formellen Gestaltung der Texte gewürdigt: In cocooning#2 lösen sich nämlich nach und nach die Textstrukturen auf, von (möglicher biologischer) Auflösung spricht das lyrische Ich, wenn es sagt „+ dann flüsterein / während mama im tritonius den tod beatmet / ♮ nicht mit ihm scheidet“. Auflösung heißt hier aber auch, wie der letzte Vers deutlich macht: das Rückgängigmachen einer Veränderung, das heißt die Rückkehr zum Zustand davor. Hier zeigt sich, wie komplex und mehrdeutig Štajners Spiel mit Sprache unter Rückgriff musikalischer Fachtermini ist.
Die Autorin integriert lautmalerische Ausdrücke („selten kloingt es so / hübsch die härchen stellen / sich auf kloing!“) und Lautstrukturen („leise / shhh / rasch überrascht / shhhhh / sagst zu viel moja draga / tssssss“) in ihre Gedichte, die das klangliche Moment von Dichtung unterstreichen. Dass letztere nicht ohne ihre performative Dimension, das heißt den Vortrag zu denken ist, machen die Partituren zu verschiedenen Gedichten deutlich, die im Band mitgeliefert werden. Diese Texte, wie auch viele andere, kann man sich in vorgetragener Form und mit musikalischer Begleitung auf YouTube anhören. Das in den Videoclips gezeigte Filmmaterial ergänzt das Gehörte und macht ein vollständigeres Erleben der Lyrik möglich. Wenn also auch die Dichtung weiterhin dem Konflikt „zwischen dem Verlangen des Dichters, eine alternative Welt zu singen“ und den eigentlichen Beschränkungen des von ihm genutzten Mediums ausgeliefert ist, so zeigt Štajner mit ihrem ersten Gedichtband, wie man innerhalb dieses Widerstreits näher an diese andere, alternative Welt heranrücken kann.

 Zu Demaart
Zu Demaart


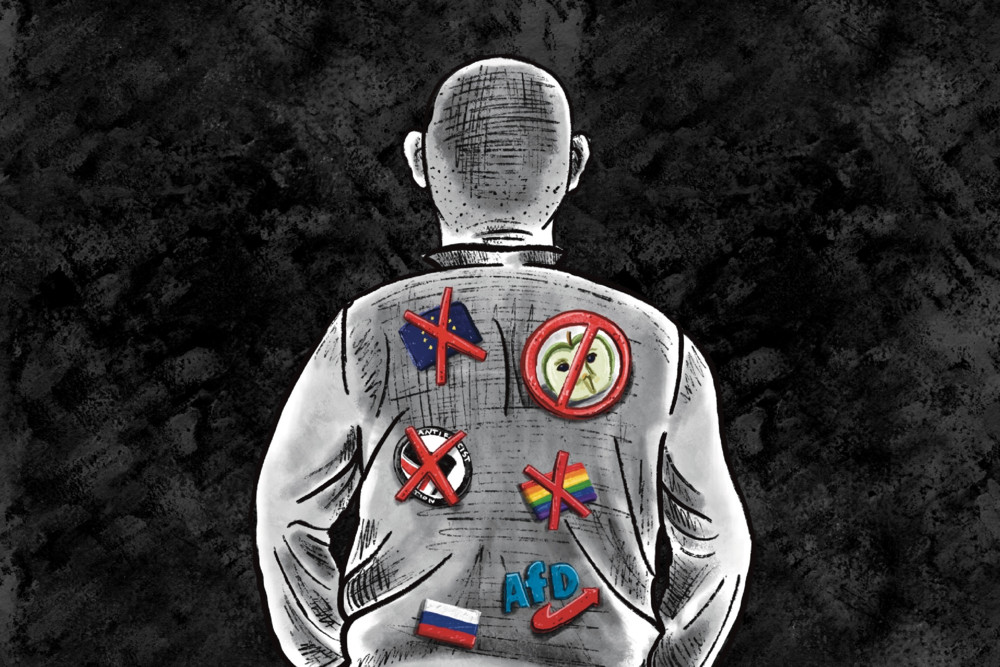




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können