Die Einsicht kommt für den Leser spät, überraschend und versteckt sich in einem an sich harmlosen Text. Das Fazit: In den großen Musik-Enzyklopädien – „Groves Dicitionary“ und „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“ (MGG) – kommt Luxemburg nicht vor. Aber auch der Umgang von Luxemburgern mit der Musikgeschichte des eigenen Landes bleibt merkwürdig distanziert. Guy Wagners Buch von 1985 über die zeitgenössischen Komponisten in Luxemburg blieb ohne größere Resonanz. Dasselbe gilt für ein Treffen der luxemburgischen Komponisten im Kulturbahnhof Igel, also außerhalb der luxemburgischen Grenzen.
Als damals ein Beobachter fragte, was denn Luxemburgs Komponisten gemeinsam hätten außer ihrer Zugehörigkeit zu Luxemburg, da löste die harmlose Frage eine erstaunlich emotionale Reaktion aus. Und auch die unbestrittene Tatsache, dass der böhmische König Jean de Luxembourg (Johann der Blinde) beinahe 20 Jahre lang Dienstherr von Europas angesehenstem Komponisten Guillaume de Machaut war, wird im Gespräch zwischen deutsch-luxemburgischen Musikfreunden kaum einmal gebührend erwähnt. Im Klartext heißt das: Die höheren Weihen der Musikwissenschaft haben das Großherzogtum noch nicht erreicht. Höchste Zeit also für ein Standardwerk, das nun wirklich die Musikgeschichte im „Ländchen“ aufarbeitet – umfassend und vielperspektivisch.
Eine Studie in acht Stationen

Damien Sagrillo, Professor an der (noch) kleinen musikwissenschaftlichen Abteilung der Universität Luxemburg, hat diese Aufarbeitung unternommen und sie unter dem einfachen, aber treffenden Titel „Musikgeschichte Luxemburgs“ veröffentlicht. „Traditionen und Schnittstellen, Brüche und Wegmarken. Eine Studie in acht Stationen“, heißt es in der Unterzeile. Sagrillos Buch besteht aus acht sogenannten „Stationen“. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit und doch erstaunlich umfassend, arbeitet der Autor das breite Spektrum der musikalischen Vergangenheit an Sauer und Mosel auf.
Die Stationen und ihre Titel stehen für sich: Station eins versteckt reichhaltige Erkenntnisse unter dem bescheidenen Titel „Musik vor der staatlichen Unabhängigkeit“, meint damit die kaum bekannte mittelalterliche Musikpflege in den Schreibstunden (Scriptorien) von Echternach. Station zwei befasst sich mit ethnologischen Aspekten des Luxemburger Musiklebens, vor allem mit den luxemburgischen Volksliedern. Station drei nimmt das Revolutionsjahr 1848 und seine politischen und kulturellen Folgen ins Visier. Station vier befasst sich mit dem heiklen Thema „Musik während der nationalsozialistischen Besatzungszeit“, umschifft dabei mit Geschick die Klippen von Verharmlosung. Die luxemburgische Unterhaltungsmusik ist Thema in Station fünf. Vor allem dieses Kapitel bietet Auswärtigen viele interessante Zusammenhänge.
Stationen sechs und sieben behandeln die musikalische Bildung im Großherzogtum, vor allem die Musikschulen und Konservatorien. In Station acht schließlich kommen luxemburgische Komponisten mit ihren Werken (musikalisch) zu Wort – beispielhaft stehen dafür Laurent Menager oder Jeannot Heinen.
Ein Werk mit enzyklopädischem Charakter
Sagrillo begrenzt seine Studien geografisch auf Luxemburg und zeitlich auf das Jahr 1970. Diese kluge Entscheidung eröffnet kommenden Forscher-Generationen ein weites Feld. Gerade die Forschung im eigenen Land ist mit Sagrillos Buch nicht beendet – im Gegenteil, der Autor eröffnet damit ein breit angelegtes Feld für wissenschaftliche Aktivität.
Die „Musikgeschichte Luxemburgs“ ist ein Werk, das hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Der wissenschaftliche Apparat – Zitate, Fußnoten, Literaturverzeichnis – ist sorgfältig erarbeitet. Und Sagrillos Resümee ist gradlinig, klar und eindeutig. „So mag es nicht verwundern, dass ich weder eine Gesamthistoriografie Luxemburgs schreiben werde, noch dazu imstande bin. Luxemburg hat als kleines Land über Erwartung ein breiter gefächertes Musikleben, als mir bisher bewusst war. Dieser Umstand hat mich auch bewogen, eine zeitliche Obergrenze festzulegen.“
Bedauerlich bleibt allerdings, dass Sagrillo kaum einmal die Großregion ins Visier nimmt. Trier, Saarbrücken oder Metz kommen im Text praktisch nicht vor. Freilich war damals Kooperation über Grenzen hinweg noch ungewohnt und ein Festival wie das in Echternach befand sich noch in den Anfängen. Ein Grund mehr, in künftigen Publikationen die Perspektive zu weiten.
Fazit: Damien Sagrillos „Musikgeschichte Luxemburgs“ ist mit rund 370 Seiten ein vergleichsweise kleines Werk. Und doch hat es so etwas wie einen enzyklopädischen Charakter. Wer es zur Hand nimmt, der stößt auf jeden Fall immer wieder auf neues Wissen und neue Erkenntnisse.

 Zu Demaart
Zu Demaart


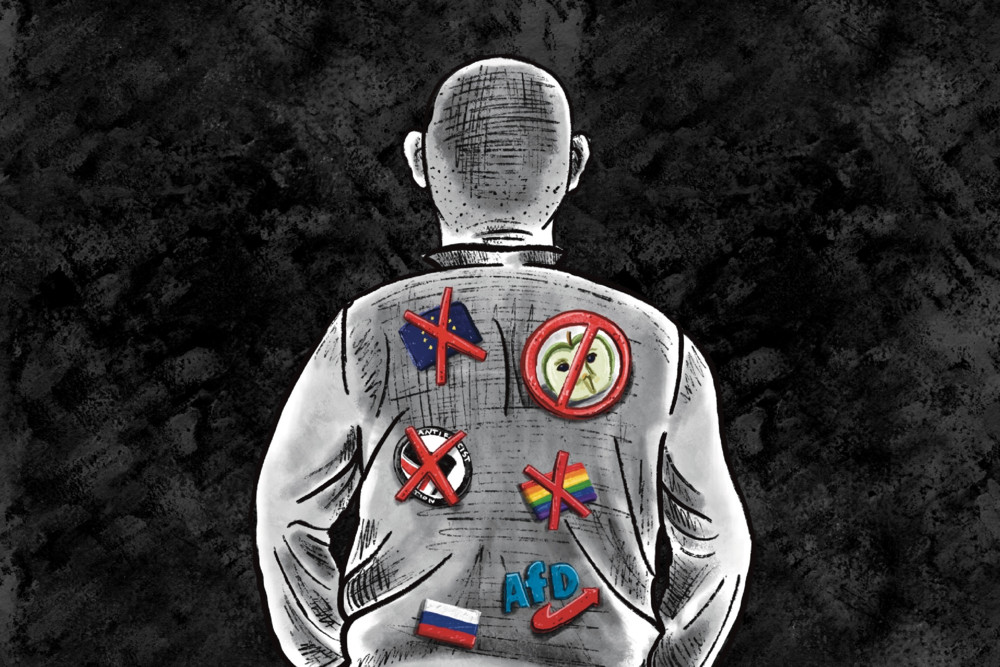




(Neues) Wissen und (neue) Erkenntnisse sind auch in dem Buch von Herrn Emile Krier aus dem Jahr 1978 "Deutsche Kultur- und Volkstumspolitik von 1933 bis 1940 in Luxemburg" zu finden. Es geht um den luxemburgischen Komponisten und Dirigenten Herrn Henri PENSIS und Radio Luxemburg und die damit verbundenen internationalen Verwicklungen. MfG Robert Hottua