Tageblatt: Die Vereinten Nationen scheinen in ihrer administrativen Sperrigkeit ein unzugängliches, schwieriges Thema. Welchen Herausforderungen mussten Sie sich stellen, um aus dieser Materie einen Roman zu gestalten – und wie viel Recherche war nötig?
Nora Bossong: Ein Roman wurde es in dem Moment, in dem ich die Figuren vor mir hatte, auch ihre privaten Konflikte und Verstrickungen, ihr Ringen ebenso wie ihre Enttäuschungen. Ein Roman wurde es aber auch in dem Moment, in dem ich merkte, dass die Wahrheitskommission eine wichtige Rolle spielen würde, ein Instrument zur Aufarbeitung schweren gesellschaftlichen Unrechts, wie es etwa die Apartheid in Südafrika war. Das Sprechen, das Erzählen ist hier zentral, ein Glaube auch an seine transformative Kraft. Darin eint es sich mit der Literatur. Und Recherche – da ist immer so viel nötig, bis man alles weiß, was man wissen will. Also im Prinzip nie genug.
In Ihrem Roman geht es um die Auswirkungen des Kolonialismus, aber auch um abruptes Dekolonisieren – die Figur von Aimé meint, in Letzterem hätte sich u.a. die „teuflische Lust (…), alles nur tiefer ins Chaos zu treiben“, manifestiert. Stellt die Form des Romans eine Möglichkeit dar, mithilfe der Verflechtung von Stimmen und Perspektiven unsere eurozentrische Geschichtsschreibung aufzubrechen?
Erst einmal ist es ein Versuch, unsere eurozentrische Geschichtsschreibung infrage zu stellen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel bis heute ausgeblendet, nicht gewusst und in der Schule auch gar nicht gelehrt wird über die koloniale Vergangenheit Europas, über die problematisch verlaufene Dekolonisierung und über die Auswirkungen bis heute. Dass Deutschland durchaus Kolonialmacht war, dass in der Zeit furchtbare Verbrechen begangen wurden, war zumindest in meiner Schulzeit noch kein Thema. Wie kann das sein? Oder nehmen wir die Kongo-Konferenz, auf der 1885 mitten in Berlin unser Nachbarkontinent wie eine Torte unter den europäischen Mächten aufgeteilt wurde. Es gab das Besitzrecht, aber das galt nur für Europäer. Oder wie Sartre schrieb: „Ohne ein Verbrechen zu begehen, erheben sie [die Kolonialisten] es zum Prinzip, dass der Kolonisierte kein Mensch ist.“ Eine Überzeugung, die bis heute Spuren in unserem Denken hinterlässt.
Aimé belächelt Mira, weil sie Hannah Arendt und Karl Jaspers zitiert – ist „Schutzzone“ auch ein Roman über Desillusionierung, über die Nutzlosigkeit unserer Lektüren, unserer intellektuellen Ausbildung?
Das würde ich nicht sagen, im Gegenteil. Es wird zwar die Theorie in Kontrast gesetzt zu unmittelbaren Erfahrungen, aber es geht eher darum, nach den Grenzen unserer Erfahrungswelt zu fragen und was das für unsere Deutungsmuster heißt. Was können wir nachvollziehen, was verstehen und warum deuten wir Ereignisse so und nicht anders?
Im Laufe des Romans wird die Geschichte des Kolonialismus aufgearbeitet – es wird an die deutsche koloniale Vergangenheit in Ruanda und Burundi angespielt, Miras Partner Wim forscht über Lothar von Trotha und die Vernichtung der Hereros. Soll der Roman auch Lücken in den historischen Kenntnissen vieler Leser schließen?
Für das Schließen all dieser Lücken wäre ein Roman ganz sicher nicht ausreichend. Aber ich hoffe, es ist ein Beitrag. Diese Themen müssten uns viel stärker präsent sein. Dass es immer noch keine offizielle Entschuldigung Deutschlands für den Völkermord an den Herero gibt, ist ja auch ein Zeichen. Wie lange will man denn noch warten? Noch mal hundert Jahre?
Mira scheint Wim zu kritisieren, weil er im Gegensatz zu ihr nicht vor Ort ist, sondern in Archiven wühlt, sich der Vergangenheit zuwendet, statt zu versuchen, in der Gegenwart etwas zu bewirken. Ist Miras Stellung nicht heuchlerisch, wenn sie in Bujumbura Pfälzer Riesling mit Mördern trinkt?
Das kommt immer sehr darauf an, was aus einem Weintrinken wird. Aimé, auf den Sie anspielen, wird als General vorgestellt, er gibt zu, Menschen getötet zu haben. Das Wort „Mörder“ fällt einmal, Mira verwendet es, aber ob Aimé tatsächlich Zivilisten getötet hat, wie es das Wort unterstellt, wird so nicht eindeutig aufgeklärt im Roman. Aimé ist eine Figur, die im Roman nicht ganz aufgeklärt wird, aber umgekehrt erkennt er Mira sehr genau und hält ihr den Spiegel vor. Und was ist Ihre Rolle in alledem, fragt er sie und zeigt ihr auf, dass es diese einfachen Aufteilungen in Gut und Böse, Innen und Außen gar nicht gibt.
Dass es immer noch keine offizielle Entschuldigung Deutschlands für den Völkermord an den Herero gibt, ist ja auch ein Zeichen. Wie lange will man denn noch warten? Noch mal hundert Jahre?
1966 wurde der Putsch in Burundi mit einer Klaviersonate von Schubert verkündet, als wären „die Schreie, die Schüsse (…) nicht mehr als der Sprung in eine andere Tonart“. Hier wird Kunst für politische Zwecke instrumentalisiert, in seinem „Kongo-Tribunal“ zeigte Milo Rau, dass Kunst konkrete politische Auswirkungen haben kann. Wie sehen Sie die Funktion und Möglichkeiten der Literatur? Kann Sie mehr, als beispielsweise die Wortwahl der UN (im Roman werden Begriffe wie Friedenstruppen oder Wahrheitskommission kritisiert) zu untergraben? Ist sie notwendig, weil alle anderen Diskurse ideologisch gefärbt sind?
Milo Raus Kongo-Tribunal sehe ich mittlerweile ein wenig kritisch. Das Anliegen dahinter teile ich vollkommen, nämlich Aufmerksamkeit zu schaffen für die hierzulande verdrängten und übersehenen Konflikte, eine auch politische Perspektive zu schaffen, und uns eint sicher auch der Glaube an die transformative Kraft des Erzählens, von der ich vorhin schon sprach. Aber meine Kritik an ihm lässt sich in seiner Vorrede zum Tribunal ganz gut aufzeigen, da betrachtet er alle vorherigen Tribunale, von Nürnberg bis Den Haag, als versagend, stellt sich selbst als die endlich eintretende Rettung dar. Das ist etwas anmaßend, und leider hat er mit seinem Theaterprojekt keinerlei juristische Mittel. Er kann das, was er den Leuten verspricht, nicht wirklich einlösen, aber er schürt Hoffnungen, er spielt mit ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit. Mit so etwas muss man extrem umsichtig sein. Vielleicht sagt es vor allem etwas über die europäische Ignoranz, wenn sehr laute Mittel notwendig sind, um Aufmerksamkeit auf Regionen wie Ostkongo zu lenken. Kunst kann viel ruhiger, dadurch aber tiefer, umsichtiger und langfristiger wirken. Sie konfrontiert uns mit Unbequemem, sie hinterfragt Gewohnheiten, sie setzt uns uns selbst aus. Das ist nicht immer gleich ein PR-Coup, und vielleicht ist das heute zu wenig, aber damit ist mir wohler.
Die Figur der „mitreisenden Gattin“ taucht oft im Roman auf und entspricht einem altmodischen Frauenbild – wollten Sie diesem Bild mit einer komplexen Erzählerin entgegenwirken, um so ein chauvinistisches Milieu zu dekonstruieren?
Ah, es wäre so schön, wenn das altmodisch und damit ad acta gelegt wäre. Ich erlebe eher, dass sich altmodische Rollen im neu-bourgeoisen Gewand aktuell großer Beliebtheit erfreuen. Hinzu kommt das Milieu – vielleicht nicht per se chauvinistisch, aber durch die unsteten Auslandseinsätze, die vielen Umzüge, das wenig Sesshafte des UN- oder auch Diplomatenlebens ist es oft so, dass in einer Beziehung einer von beiden zugunsten der Karriere des anderen zurückstecken muss. Und bis heute scheinen mir häufiger Frauen bereit zu sein, ihre Karriere der Beziehung unterzuordnen als Männer. Das mag sich natürlich wandeln, aber halt peu à peu.
Milo Rau kann das, was er den Leuten verspricht, nicht wirklich einlösen, aber er schürt Hoffnungen, er spielt mit ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit
Es gibt in Ihrem Roman Orts- und Handlungssprünge, das Innenleben von Mira wird in langen Schachtelsätzen geschildert, die Intimes und Politisches mit einer sehr präzisen Beschreibung der Schauplätze vermischen – hat das komplexe Thema den Stil des Romans konditioniert? Hätte der Roman mit einer linearen Erzählweise funktionieren können?
Die nichtlineare Erzählweise folgt einer wie ich finde viel schlüssigeren Erzähllogik als der Chronologie, nämlich der Logik des Erinnerns. Mira erinnert sich ja bruchstückhaft, nach und nach, sie nähert sich stolpernd an ihre eigene Vergangenheit und die Vergangenheit zweier Kontinente, mal widerwillig, mal sehnsüchtig, mal forsch. In dem Sinne: Natürlich hätte ein linear erzählter Roman funktionieren können, es wäre nur ein ganz anderer geworden, mit einer ganz anderen Hauptfigur.
Bei Miras Berichterstattung für die UN geht es oftmals darum, die Wahrheit so auszulegen, dass die Arbeit der UN nicht als Scheitern verbucht werden kann – ein Massaker soll bspw. auf keinen Fall nachher als Genozid in die Geschichtsschreibung eingehen. Wie wichtig ist die Wortwahl bei Geschichtsschreibung? Würden Sie die Berichterstattung der UN mit dem literarischen Schreiben kontrastieren?
Ein großes Thema. Vielleicht nur so viel dazu: Es gibt ja durchaus gute Gründe, warum man nicht vorschnell das Wort Genozid verwendet, wenn die Ereignisse noch nicht völlig geklärt sind. Ebenso kann es durchaus schlimme Folgen haben, wenn das Wort erst zu spät verwendet wird, sich die internationale Gemeinschaft aus den souveränen Angelegenheiten eines Staates herausgehalten hat, ob aus Feigheit, Bequemlichkeit oder aus Vorsicht. Da sind wir mitten drin im Völkerrecht, und das würde hier den Rahmen sprengen.
Miras Erzählung ist sowohl melancholisch als auch zynisch, es gibt die Schutzzone, die man in zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechterhält (oder aufgibt), und die politischen Schutzzonen – wie wichtig war Ihnen das Verzahnen von Miras Privatleben und den geopolitischen Herausforderungen, die ihren Alltag ausmachen? Ist die Figur der Helena deswegen von Bedeutung?
Das Leben hat keine klare Trennung zwischen den politischen und den zwischenmenschlichen Beziehungen, sie verzahnen sich, das eine kann Auslöser des anderen sein oder auch Flucht davor, manchmal koexistieren beide Sphären nur still. Aber beide sind da, wenn wir nicht ganz blind sind. Warum sollte ein Roman so tun, als wäre es anders?



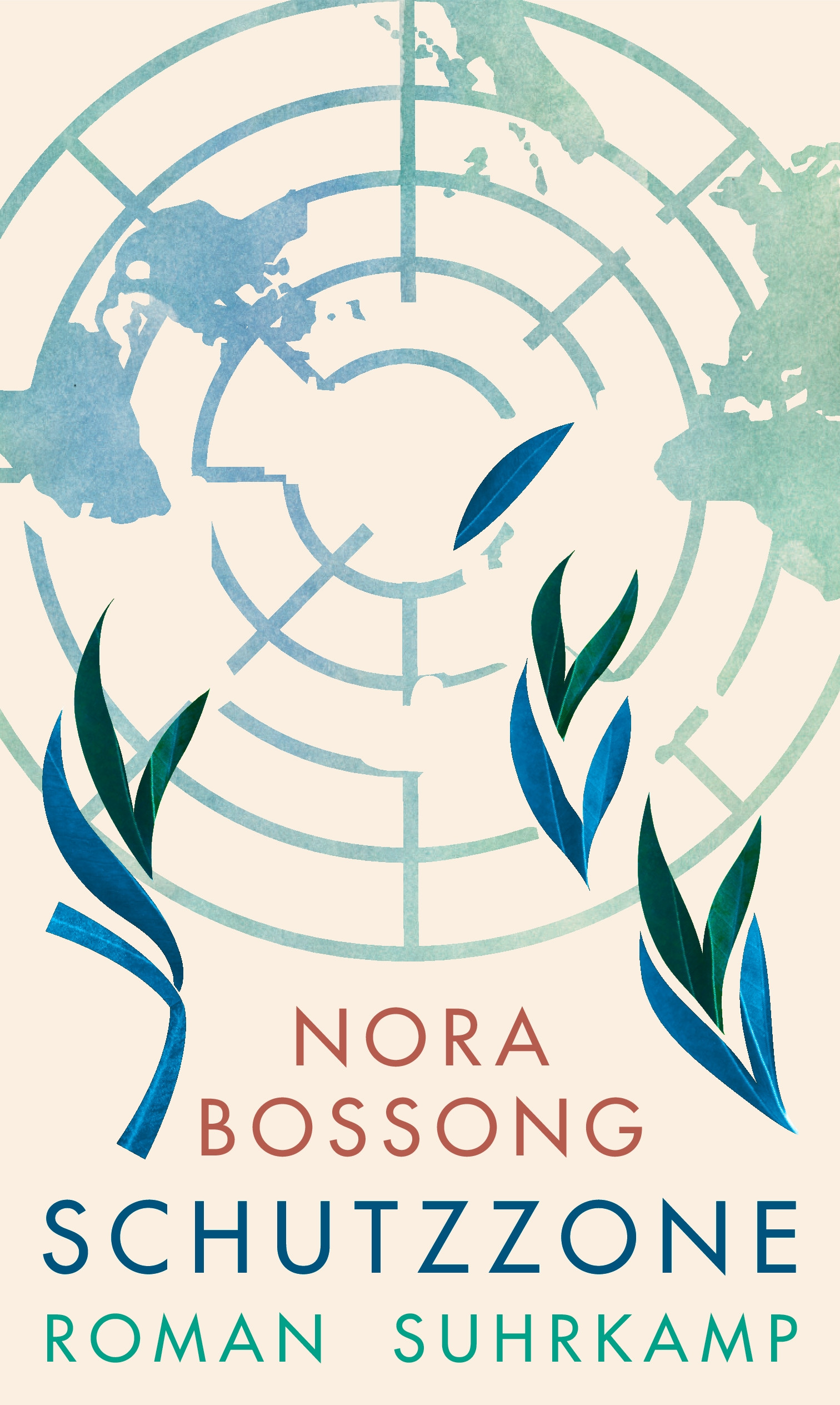
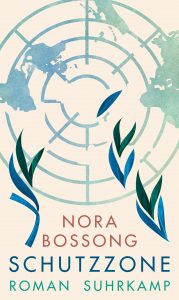







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können